Montag, 2. Juni 2025
Leselounge: Rike van Kleef - Billige Plätze
Montag, 14. April 2025
Leselounge: Rafael Schmauch - Battlerap
Donnerstag, 4. April 2024
Leselounge: Sebastian Krumbiegel - Meine Stimme
Mittwoch, 18. Oktober 2023
Leselounge: Simon Reynolds - Futuromania
Dienstag, 13. Dezember 2022
Leselounge: Dave Grohl - Der Storyteller
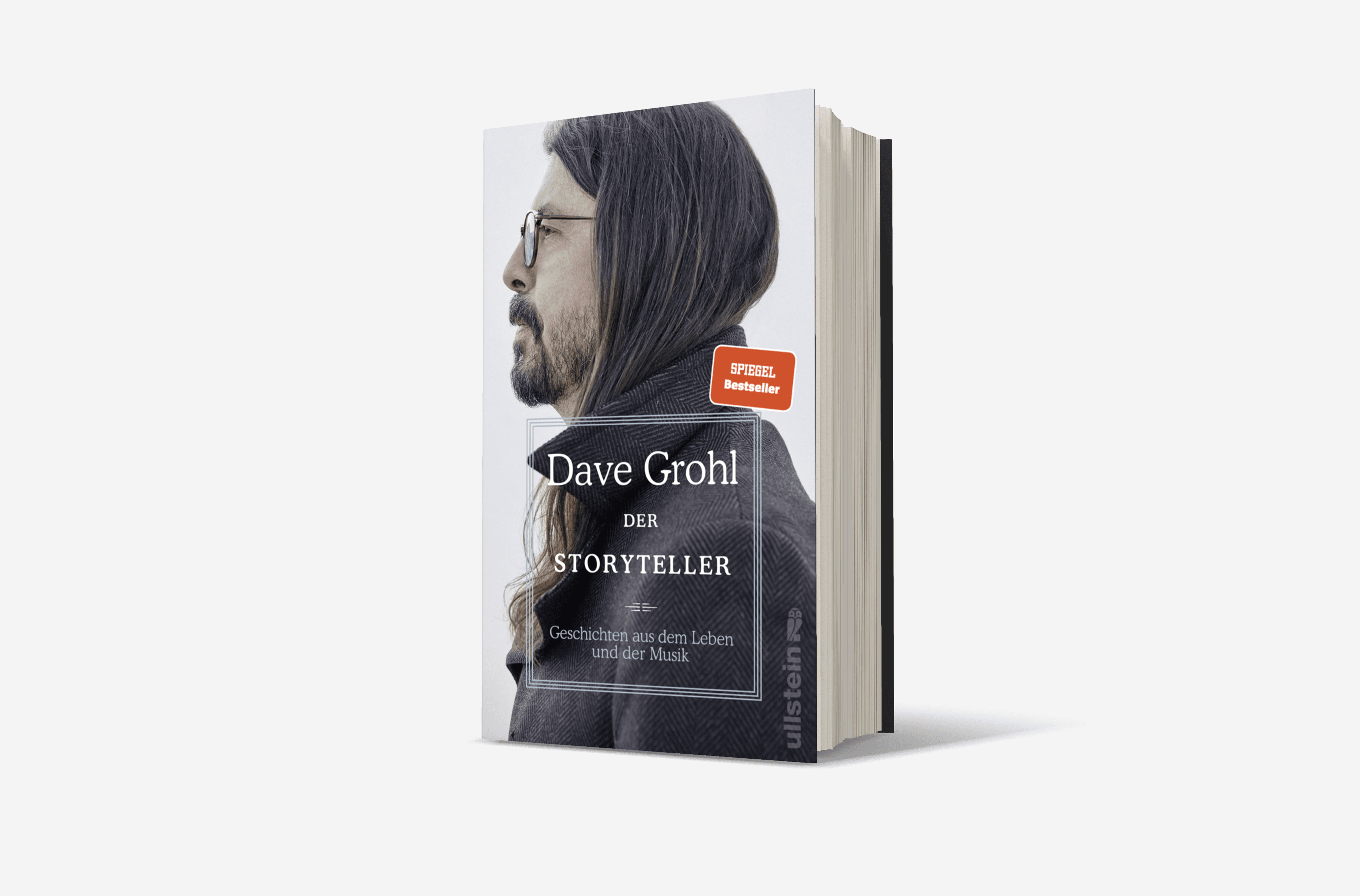 |
| Quelle: Ullstein.de |
Dienstag, 21. Juni 2022
Leselounge: Negativ-dekadent - Punk in der DDR
 |
| Quelle: ventil-verlag.de |
Was mir auch haften blieb, ist, dass die Szene nicht nur sehr klein war. Daraus ergibt sich automatisch, dass es wenige Veranstaltungen und Treffpunkte gab, wo sie sich treffen konnten. Oft waren es nur zwei, drei, vier Gigs pro Jahr, wo Menschen aus Zwickau, Erfurt und sonst wo dann angetingelt kamen. Allzu romantisch darf man sich das nicht vorstellen.
Montag, 28. März 2022
Leselounge: Hendrik Bolz - Nullerjahre
 |
| Quelle: kiwi-verlag.de |
Montag, 20. Dezember 2021
Luserlounge Adventskalender, Türchen 20: Leselounge - Awesome HipHop Humans
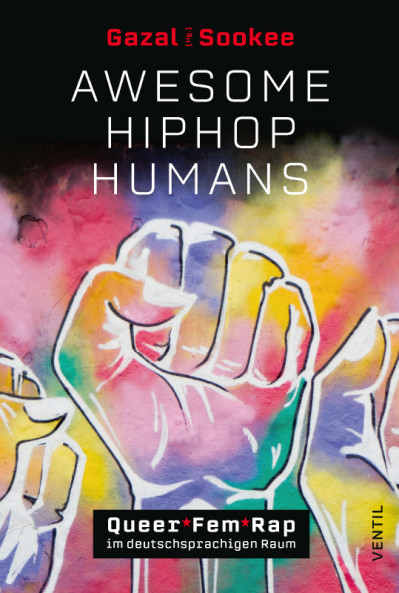 |
| Quelle: ventil-verlag.de |
Mittwoch, 20. Oktober 2021
Leselounge: Davide Bortot und Jan Wehn - Könnt ihr uns hören?
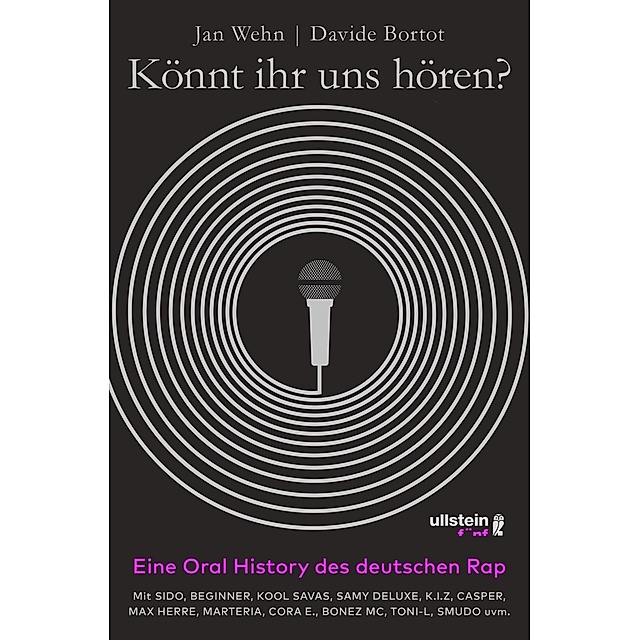 |
| Quelle: weltbild.de |
(ms) Was in diesem Buch wirklich überzeugt, ist die Art und Weise des Schreibstils. Dies ist eine sogenannte Oral History (so wie hier und dort). Das heißt, die ProtagonistInnen, um die es geht, sprechen selbst ohne inhaltliche redaktionelle Bearbeitung. Was für ein irrer Aufwand!
Den haben sich Jan Wehn und Davide Bortot aber gerne gemacht für ihr Buch Könnt Ihr Uns Hören? Es ist bereits in der Unterüberschrift zu lesen, dass es eine Abhandlung über die Geschichte des deutschsprachigen Rap geht. Das klingt so simpel, so gut überschaubar. Ist es mitnichten! Diese Wirrungen, Wege, Keimzellen, Bewegungen, Motivationen haben die Autoren so gut durch ihre Beteiligten klar werden lassen, dass es beinahe frech ist! So gut ist dieses Buch! Es liest sich tatsächlich wie ein Krimi, es ist richtig spannend! Denn die Frage, wie sich Rap hier entwickelt hat, geht immer mit der Frage her: Warum genau so und nicht anders! Das wird so gut aufgeschlüsselt und geklärt, dass ich als Außenstehender einen erstklassigen Überblick bekomme. Was für ein Verdienst der Autoren und was für eine Offenheit der MusikerInnen.
Das hier ist keine Nischenliteratur. Hören tue ich Rap sehr gerne, aber halt auch super ausgewählt, ist ja klar. WTG, Fatoni, Juse Ju, Audio88, Yassin, sookee, Mädness, Döll. Diese Ecke. Als Jugendlicher habe ich selbstredend auch Aggro Berlin, Massive Töne und Fettes Brot gehört. Die Zeiten ändern sich.
Dieses Werk entknotet ein ziemlich großes Wollknäuel an Musikgeschichte und -kultur. Es geht zum einen immer wieder um die großen Wegbereiter und deren unangefochtenes Können am Mikrophon. Cora E., Samy Deluxe, Stieber Twins, Torch, Kool Savas.
Was mich jedoch so begeistert hat, ist, dass klar wurde, warum welche Kreise wie gerappt haben. Die RapperInnen aus Stuttgart, Hamburg und insbesondere Berlin hatten grundsätzlich unterschiedliche Gründe, genauso zu rappen, wie sie es taten. Da ging mir echt ein Licht auf. Allein das ist schon extrem lesenswert! Zudem werden hier selbstredend auch einzelne Stücke ausreichend gewürdigt, die heute immer noch Klassiker sind.
Rap war lange Zeit die absolute Nische, kommerziell unbedeutend. Heute sieht es gänzlich anders aus. Schaut man sich insbesondere Abrufzahlen bei Streamingdiensten an, ist es Rap, der dominiert. Rap ist Mainstream, die vorherrschende musikalische Kultur geworden. Doch eine Krux fällt mir dabei ein. Werden seit Jahren Fettes Brot und noch viel stärker Die Fantastischen Vier dafür gerüffelt, whack zu sein, kann man nicht zwingend behaupten, dass die Autotune-Fraktion true ist. Auch Marteria würde ich nicht mehr als hundertprozentigen Rapper titulieren. Das ist auch Pop mit Sprechgesang. Nun gut...
Dies ist also ein herausragendes Buch, in dem immer wieder zu spüren ist, wie viel Arbeit und Herzblut darin steckt. Eine Sache nur ist als Rap-Außenseiter gewöhnungsbedürftig. Wichtig: Das hier ist keine Wertung. Die Sprache im Rap ist eine andere, als die ich gewohnt bin. Worte wie true oder whack befinden sich nicht in meinem aktiven Wortschatz. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Daran muss man sich gewöhnen, dann steht einem eine neue Welt offen.
Sonntag, 8. August 2021
Leselounge: Christopf Dallach - Future Sounds
 |
| Quelle: suhrkamp.de |
Eigentlich gibt es auch nur einen Unterschied zwischen Future Sounds und Electri_City, könnte man provokant in den Raum werfen. Esch hat sich radikal auf den Düsseldorfer Raum beschränkt und somit ein sehr klares Bild aus einem sehr kleinen Raum erschaffen. Bestechend dabei, wie einzelne Straßennamen und Clubs wichtig wurden.
Christoph Dallach, der unter anderem für die ZEIT schreibt, spannte den Bogen wesentlich weiter, warf den Blick auf die ganze BRD, England, Frankreich. Daher stehen beide Bücher überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sie ergänzen sich in hervorragender Weise! Future Sounds ist ein Buch, das die unterschiedlichen Bewegungen des Krautrock ins Visier nimmt. Den Krautrock gibt es nicht. Das kann eine der wesentlichen Thesen sein, die immer wieder durchleuchten. Viele Bands kannten sich untereinander gar nicht, die heute, viele Jahre später in einen Topf geworfen werden. Und das ging mir bei den gut 500 Seiten beim Umblättern ständig so.
Ich bin viel zu jung, um irgendeine Verbindung zum Krautrock zu haben. Dass dieses Genre nun wiederentdeckt wird, würde ich für meine Generation auch überhaupt nicht behaupten. Die um-die-30-Jährigen aus meinen Kreisen kennen, wenn es gut läuft, Kraftwerk. Punkt. Klar, die Düsseldorfer waren auch mein Ausgangspunkt. Doch nun, nach der Lektüre beider Werke, ist mir eines total klar: Die waren immer unglaublich verschroben. Genial, aber auch irgendwie autistisch. Die wollten mit dem Rest auch gar nichts zu tun haben. Sicherlich waren sie ab den 70ern auch wesentlich zugänglicher als manch andere. Ein großer Pluspunkt an Future Sounds ist eben, dass Kraftwerk hier nur gestreift werden (und ein Minuspunkt dieses Textes, dass ich das erwähne).
Andere Bands haben eine wesentlich bessere Geschichte zu erzählen. Ihre Namen und Mitglieder waren mir vorher auch vollkommen unbekannt. Dallach hat mir hier eine Wissenslücke gefüllt. Vielen Dank an dieser Stelle. Logisch, von Can habe ich auch gehört, aber mich nie so wirklich mit der Gruppe beschäftigt. Tangerine Dream, Faust, Amon Düül oder gar Amon Düül II sagten mir vorher nichts. Jetzt bin ich schlauer und ziemlich angefixt. Hört man beispielsweise Faust, wird schnell klar, dass deren Musik mit Kraftwerk nichts zu tun hat. Nochmal: Der Begriff Krautrock vereinheitlicht nicht zu Vereinheitlichendes.
Genau wie bei Esch sind es hier die Menschen, die ihre Geschichten erzählen. Genau das macht diese Lektüre so unglaublich einnehmend. Viele ProtagonistInnen sind vollkommen durchgeknallte Leute. Klangnerds ohne Ende. Pioniere auch oft. Das Wunderbare an diesem Buch geschieht gleich zu Anfang. Da spannt Christoph Dallach den Bogen sehr gut: Von der Musik, wie es sie vor dem zweiten Weltkrieg gab und welche Sehnsucht und welches Selbstverständnis danach hierzulande herrschte. Wo es noch Anknüpfungspunkte gab, was sich nicht schickte und wo radikal gedacht wurde, gedacht werden musste. Phantastisch.
Sehr unterhaltsam ist dieses Buch. Und ehrlich. Einige Menschen widersprechen sich in ihren Meinungen, Anschauungen. Dass das genau so stehen gelassen wird, ohne jeglichen Kommentar oder redaktionellen Eingriff, ist so einfach wie mutig.
Wer also etwas über eine sehr kleine Szene wissen will, die erst viel, viel später Anerkennung bekommen hat, nie erfolgreich und dennoch so unglaublich prägend war, sei dieses Buch an die Hand gelegt. Ich fand mich eines Abends wieder und sah mir eine Doku über Karlheinz Stockhausen an. Hätte ich vorher auch nicht gedacht.
Samstag, 19. Dezember 2020
Leselounge: Rüdiger Esch - Electri_City
 |
| Quelle: jpc.de |
Ob das Gegenteil davon die Motivation von Rüdiger Esch gewesen ist, kann ich nicht sagen. Von Haus aus ist Esch kein Autor und auch nicht Journalist, sondern Musiker. Er spielt seit unzähligen Jahren bei Die Krupps und Male. Hat also seit Jahrzehnten einen phantastischen Einblick in die Entwicklung der Branche, des Klangs, der Menschen.
Ja, Eletri_City gewährt einen wunderbaren Einblick in die Zeit der großen Bewegungen in und um Düsseldorf. Insbesondere die tollen Würdigungen zu Conny Planks Werk sind dort genau an der richtigen Stelle. Denn man lernt eine Menge Leute kennen, die im Hintergrund agierten und dennoch unverzichtbar für den Klang, die Experimente, die Umsetzung gewesen sind.
Große Empfehlung! Man sollte nebenbei auch immer wieder nachhören, worum es momentan geht, dann ist das Buch umso runder! Wie schön, dass es mittlerweile gleich zwei Sampler passend dazu gibt!
Gerne wollte ich auch noch die Band erwähnen, die mich auf die Lektüre aufmerksam gemacht haben. Leider komme ich nicht mehr auf den Namen. Irgendwann im Frühsommer haben sie teilgenommen beim morgendlichen Newsletter vom ZEITmagazin. Ich glaube es war eine Jazz-Kombo aus dem Rheinland... Daher: Ein großes, unbekanntes Dankeschön für diesen herrlichen Lesetipp!



